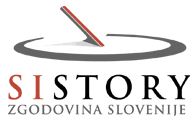/
Serijske publikacije
/
Zgodovina za vse
»Obsojamo vsakršno vedeževanje, čaranje ...«
Navodila duhovnikom ljubljanske škofije glede praznoverja v 17. in prvi polovici 18. stoletja
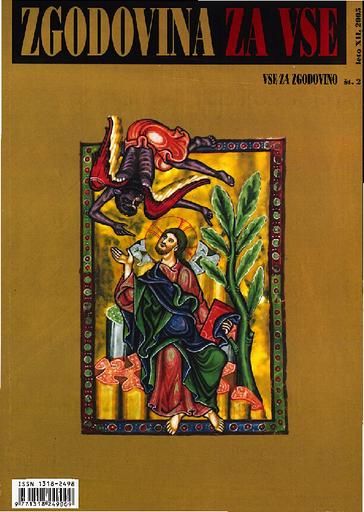
Avtor(ji):Lilijana Žnidaršič Golec
Soavtor(ji):Andrej Studen (ur.)
Leto:2005
Založnik(i):Zgodovinsko društvo, Celje
Jezik(i):slovenščina
Vrst(e) gradiva:besedilo
Ključne besede:ljubljanska škofija, praznoverje, duhovniki, 17./18. st., Ljubljana Diocese, superstition, priests, 17th-18th century
Avtorske pravice:

To delo avtorja Lilijana Žnidaršič Golec je ponujeno pod Creative Commons Priznanje avtorstva-Nekomercialno-Brez predelav 4.0 Mednarodna
Datoteke (1)
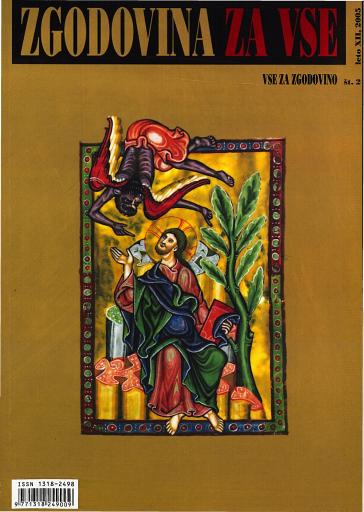
Ime:2005_2_Zgodovina-za-vse.pdf
Velikost:7.38MB
Format:application/pdf
Stalna povezava:https://hdl.handle.net/11686/file297
Opis
Med letoma 1600 in 1750 sta duhovnikom ljubljanske škofije navodila glede praznoverja posredovala dva sinodalna
odloka: do nekako zadnje četrtine 17. stoletja odlok »O magiji in praznoverju ter njunih vrstah«, nato pa »Dekret o tem, naj
se za zdravljenje bolezni ne deli lističev«. V prispevku je predstavljena vsebina obeh besedil, v dokaj.šnji meri pa tudi kontekst,
v katerem sta tidve nastali. Vsebinska (in delno slogovna) primerjava naj bi opozorila na širše mentalitetno ozadje.
Metapodatki (12)
- identifikatorhttps://hdl.handle.net/11686/2136
- naslov
- »Obsojamo vsakršno vedeževanje, čaranje ...«
- Navodila duhovnikom ljubljanske škofije glede praznoverja v 17. in prvi polovici 18. stoletja
- »We hereby condemn any and all fortune-telling, witchery...«
- Instructions issued to the priests of the Ljubljana Diocese in the seventeenth and early eighteenth century regarding superstition
- „Wir verurteilen jegliche Wahrsagerei, Zauberei..."
- Instruktionen für Geistliche der Diözese Laibach im 17. und in der ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts
- avtor
- Lilijana Žnidaršič Golec
- soavtor
- Andrej Studen (ur.)
- predmet
- ljubljanska škofija
- praznoverje
- duhovniki
- 17./18. st.
- Ljubljana Diocese
- superstition
- priests
- 17th-18th century
- opis
- Between 1600 and 1750 the priests of the Ljubljana Diocese were instructed how to deal with (popular) superstition by two synodal ordinances: up to the last quarter of the 17th century, by the ordinance entitled »On Magic and Superstition and The Types of Such Practices« after that by the »Decree Prohibiting the Distribution of Healing Leaflets Among the People.« The article presents the contents of both documents, as well as the context in which they were created. A comparison of the contents of both documents (and partly of their style) gives an insight into the general mental background of the time.
- Med letoma 1600 in 1750 sta duhovnikom ljubljanske škofije navodila glede praznoverja posredovala dva sinodalna odloka: do nekako zadnje četrtine 17. stoletja odlok »O magiji in praznoverju ter njunih vrstah«, nato pa »Dekret o tem, naj se za zdravljenje bolezni ne deli lističev«. V prispevku je predstavljena vsebina obeh besedil, v dokaj.šnji meri pa tudi kontekst, v katerem sta tidve nastali. Vsebinska (in delno slogovna) primerjava naj bi opozorila na širše mentalitetno ozadje.
- erhielten die Geistlichen der Laibacher Diözese im 17. und in der ersten Hälfte des 18. Jahrhunderts insbesondere in zwei Erlässen, die auf mehreren Bischofssynoden in Ljubljana und Gornji Grad verlautbart wurden. Im ersten Erlass, der von den Bischöfen Rinaldo Scarlichi (1630- 1640) und Oton Friderik Buchheim (1641-1664) verkündet worden war - möglicherweise auch von Scarlichis Vorgänger Tomaž Hren (1597- 1630) und Buchheims Nachfolger Jožef Rabatta (1664-1683) - wurden die Geistlichen aufgefordert, das Denken der Gläubigen vom Aberglauben zu säubern. Sie sollten vor allem einfache Leute ermahnen und überzeugen, mit denen sie - den Instruktionen nach zu urteilen - in ihrer seelsorgerischen Tätigkeit meist zu tun hatten. Die Gläubigen würden durch verschiedene betrügerische „Hexen und Zauberer und Wahrsagerinnen" zum Aberglauben verleitet, mit denen sich die Priester aber anscheinend nicht eigens befassen sollten. Nur diejenigen „Hexen" sollten dem Bischof gemeldet werden, die vom Aberglauben gewissermaßen abhängig waren. Der zweite Erlass, der erstmals im Jahr 1699 bezeugt ist, als Sigmund Krištof Herberstein (1683-1701) den Laibacher Bischofsstuhl innehatte, verlangte von den Geistlichen zweierlei: Erstens sollten sie selber keine Segen und Zaubersprüche gegen Krankheiten erteilen. Zweitens sollten sie ihre Gläubigen überzeugen, „Gesundbetern, Zauberern, Wahrsagern und (anderen) abergläubischen Betrügern" nicht zu vertrauen, denn diese könnten mit ihren Ratschlägen und Gegenständen sterbliche Wesen nicht wirklich heilen. In beiden Dekreten figurierte der Aberglaube nicht nur als unschuldiger „leerer Glaube", als Naivität von Nichtwissern und Verführten. Abergläubisches Denken und Handeln stellten eine ernste Gefahr dar, da dabei angeblich des Teufels Wirken im Spiel war, der dem nach Gottes Ebenbild erschaffenen Menschen das ewige Leben und Glück mit Gott nicht gönnt, sondern ihn von Gott abwenden und der Verdammnis preisgeben will. Die Synodalerlässe stellten die mögliche Gefährdung der gesellschaftlichen Ordnung nicht in den Vordergrund. Diese Dimension kam bei Hexenprozessen zum Ausdruck, die allerdings vor weltlichen und nicht vor kirchlichen Gerichten stattfanden, wenn Laien der Hexerei verdächtigt wurden. Die Instruktionen für Geistliche der Laibacher Diözese hinsichtlich des Aberglaubens sind also - mit Ausnahme des sanktionierten Verbots des Austeilens „abergläubischer Blätter" - in erster Linie als Empfehlungen der Diözesanführung zu sehen, deren Ziel die Beseitigung abergläubischen Denkens war. Die empfohlene Methode waren Belehrungen, was man anhand des jüngeren Dekretes auch als „Aufklärung" bezeichnen könnte. Es ist wohl kein Zufall, dass dieses Dekret noch im Jahr 1774 von der Synode in Laibach verkündet wurde.
- založnik
- Zgodovinsko društvo
- datum
- 2005
- tip
- besedilo
- jezik
- Slovenščina
- jeDelOd
- pravice
- licenca: ccByNcNd